Hand in Hand
Vorwort
Diskriminierung tut weh –
unabhängig vom Diskriminierungsgrund!
In Österreich gibt es viele verschiedene gesetzliche Grundlagen, die Diskriminierung verbieten: Beispiele sind die österreichische Verfassung, das Bundesgleichbehandlungsgesetz, die verschiedenen Landesgleichbehandlungsgesetze, das Behindertengleichstellungsgesetz, das EGVG und andere mehr.
Diese Vielfalt an gesetzlichen Regelungen macht es dem/der Einzelnen oftmals schwer, den richtigen Weg zu finden, um sich gegen eine Diskriminierung zu wehren.
Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Sie zu beraten und zu unterstützen, wenn Sie diskriminiert wurden. Wir zeigen Ihnen die möglichen Schritte, begleiten Sie dabei oder stellen für Sie den Kontakt zu anderen Einrichtungen her, die Ihnen helfen können, wenn wir es nicht können.
Vielfältig sind auch die Gründe, weswegen Menschen diskriminiert werden. Damit Sie einen Überblick über die verschiedenen Diskriminierungsgründe haben, zählen wir sie hier auf, erklären den gesellschaftlichen Hintergrund und nennen konkrete Beispiele. Wenn es Gerichtsurteile zu den Beispielen gibt, geben wir die Signatur an, mit der Sie das Urteil im Internet nachlesen können (www.curia.europa.eu für EUGH-Entscheidungen oder www.ris.bka.at für Entscheidungen österreichischen Gerichte, www.frauen.bka.at für Entscheidungen der österreichischen Gleichbehandlungskommission oder www.klagsverband.at für Fälle des Klagsverbandes).
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts

Beispiele:
Eine Frau verdient für die gleiche Arbeit weniger als ihr männlicher Kollege.
Eine Versicherung verrechnet bei ihren Krankenversicherungsprämien höhere Prämien für Frauen, insbesondere wegen des „Risikos“ möglicher Schwangerschaften
(EUGH-Urteil vom 01.03.2011 – Rs C 236/6 Test-Achats).
Eine Frau will Taucherin bei der Feuerwehr werden. Ein Kriterium für die Aufnahme ist das Lungenvolumen. Der erforderliche Mindestwert orientiert sich am Durchschnittswert der männlichen Lunge. Die Frau sieht daher von einer Bewerbung ab, da sie glaubt, dieses Kriterium nicht erfüllen zu können.
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit dem Geschlecht ist eine sexistische Diskriminierung. Das Geschlecht dient der männlichen Mehrheitsbevölkerung dazu, Frauen und Transgenderpersonen als „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss von Frauen und Transgenderpersonen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit dem Geschlecht zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe

Beispiele:
Einem Mann mit dunkler Hautfarbe wird der Eintritt in eine Diskothek aufgrund seiner Hautfarbe verweigert
(vgl. ZRS Wien 36R198/10z vom 30.08.2010).
Eine HTL-Absolventin mit dunkler Hautfarbe bewirbt sich bei einer Leasing-Firma um eine Stelle als Software-Entwicklerin. Die Firma nimmt die Daten der Frau auf und schickt der Bewerberin laufend Stellen als Hilfskraft im Reinigungsbereich.
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Hautfarbe ist eine rassistische Diskriminierung.
Die Hautfarbe dient der „weißen“ Mehrheitsbevölkerung dazu, „nicht weiße“ Menschen als „fremd“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen.
Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Hautfarbe zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit

Beispiele:
Der Direktor eines Betriebes sagt öffentlich, dass er keine Menschen fremder Herkunft einstellen wolle, da seine Kundinnen und Kunden Bedenken diesbezüglich hätten
(EUGH-Urteil vom 10.07.2008 Rs C 54/07 Feryn).
Einer Frau, die eine Kfz-Versicherung abschließen will, wird mitgeteilt, dass sie einen höheren Beitrag zahlen muss, da sie nicht österreichischer Herkunft ist.
Einem Ehepaar aus der Türkei wird eine Wohnung nicht vermietet, weil der/die VermieterIn annimmt, dass das Ehepaar aufgrund seiner „Kultur“ zu oft zu viele Personen in der Wohnung als Gäste aufnehmen wird
(vgl. Gleichbehandlungskommission III/3/05).
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der ethnischen Zugehörigkeit ist eine rassistische Diskriminierung. Dabei dient der „einheimischen“ Mehrheitsbevölkerung die tatsächliche oder vermeintliche „nicht einheimische“ ethnische Zugehörigkeit von Menschen dazu, diese Menschen als „fremd“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der ethnischen Zugehörigkeit zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Ethnie ersetzt im Deutschen den früher in diesem Zusammenhang verwendeten Begriff „Rasse“, seit erkannt wurde, dass der Begriff „Rasse“ für die Verwendung zur Unterscheidung von Menschengruppen wissenschaftlich falsch und daher unbrauchbar ist. Der Begriff „Ethnie“ hat seinerseits einen engen Zusammenhang zum Begriff „Kultur“, da ethnische Gruppen nicht zuletzt durch die vermeintlichen oder tatsächlichen kulturellen Gemeinsamkeiten ihrer Mitglieder definiert werden.
Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, des Vermögens und der Geburt

Beispiele:
SchülerInnen, die Lernschwierigkeiten oder Teilleistungsschwächen haben und deren Eltern sozial benachteiligt sind, werden in der Schule ausgegrenzt und beleidigt
(vgl. 31. Bericht der Volksanwaltschaft 2008, S. 333f.).
Ein Kind sozial benachteiligter Eltern erhält in der Schule nicht das gleiche Ausmaß an Förderung durch die LehrerInnen wie ein Kind vermögender Eltern, weil die LehrerInnen davon ausgehen, dass das Kind keine förderwürdigen Perspektiven hat. Die Kinder aus sozial benachteiligten Familien werden in einer eigenen Klasse zusammengefasst („Restlklasse“).
In einem Kurs für erwachsene Arbeitssuchende erhält ein langzeitarbeitsloser Mann mit Hauptschulabschluss und Berufserfahrung als Metallhelfer ein geringeres Ausmaß an Betreuung durch den/die KursleiterIn als die arbeitslose Frau mit akademischem Abschluss und Berufserfahrung als Sozialpädagogin.
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft, dem Vermögen oder der Geburt ist eine klassistische Diskriminierung. Dabei dient der wohlhabenden Mittel- und Oberschicht die tatsächliche oder vermeintliche Zugehörigkeit von Menschen zur nicht wohlhabenden Mittel- und Unterschicht dazu, diese als „arm“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft, dem Vermögen oder der Geburt zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Diskriminierung aufgrund genetischer Merkmale

Beispiele:
Bei einem Bewerbungsgespräch wird von dem/der BewerberIn ein Gentest verlangt. Aus dem Test geht hervor, dass der/die BewerberIn ein überdurchschnittliches Risiko trägt, an Krebs zu erkranken. Der/Die ArbeitgeberIn stellt den/die BewerberIn deswegen nicht ein.
Genetische Merkmale werden vor allem in Zukunft vor dem Hintergrund der Gendiagnostik eine Rolle spielen: Genetische Daten könnten zur Prognose bestimmter Krankheiten verwendet werden. Dies enthält die Gefahr, Menschen mit bestimmten Prognosen am Arbeitsmarkt oder bei Versicherungsverträgen zu benachteiligen.
Diskriminierung aufgrund der Sprache

Beispiele:
Eine Mutter spricht in einem öffentlichen Verkehrsmittel mit ihrem Kind arabisch und wird deshalb von einem Fahrgast beschimpft und beleidigt.
In einem Jobinserat wird unter anderem „perfektes Deutsch“ als Aufnahmekriterium genannt. Darüber hinaus geht aus dem Inserat nicht hervor, welche konkreten sprachlichen Leistungen im Rahmen der angebotenen Arbeitsstelle erbracht werden müssen.
Die Benachteiligung von Menschen nicht deutscher Erstsprache im Zusammenhang mit der Sprache ist eine rassistische Diskriminierung. Dabei dient der „einheimischen“ Mehrheitsbevölkerung, deren Erstsprache Deutsch ist, die Tatsache, dass Menschen Deutsch als Zweitsprache erlernten, dazu, diese Menschen als „fremd“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Sprache zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Die Benachteiligung von Menschen mit Deutsch als Erstsprache im Zusammenhang mit der Sprache ist eine Form der klassistischen Diskriminierung. Dabei dient der „gut gebildeten“ Mehrheitsbevölkerung, deren Alltagssprache ein „elaboriertes“ Deutsch ist, die Tatsache, dass Menschen, die ein weniger „elaboriertes“ Deutsch sprechen, dazu, diese als „ungebildet“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen.
Diskriminierung aufgrund der Religion

Beispiele:
Eine Ärztin mit muslimischem Kopftuch wird bei einem Bewerbungsgespräch in einer Kuranstalt eine Anstellung unter der Bedingung zugesagt, dass sie das Kopftuch bei der Arbeit mit Patientinnen und Patienten ablegt (Fall Klagsverband und Gleichbehandlungskommission II/22).
Eine Mutter will ihr Kind bei der Tagesmutter anmelden. Diese verweigert die Betreuung des Kindes, da es muslimischen Glaubens ist (GBK III/31/07).
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Religion ist in Österreich größtenteils eine antiislamische, rassistische Diskriminierung. Dabei dient der christlich-katholisch geprägten Mehrheitsbevölkerung die Zugehörigkeit von Menschen zu einer nicht christlich-katholischen Religion dazu, diese Menschen als „fremd“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Religion zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung und der politischen oder sonstigen Anschauung

Beispiele:
Eine Person engagiert sich privat in einer politischen Partei und wird deshalb von dem/der DienstgeberIn bei der internen Gehaltsvorrückung übergangen (vgl. Gutachten Gleichbehandlungskommission II vom Februar 2010).
Eine Person engagiert sich für ein alternatives Wirtschaftssystem, demonstriert dafür und äußert sich diesbezüglich in Medien. Aufgrund dessen wird sie von dem/der ArbeitgeberIn gekündigt.
Eine Person wird aufgrund ihrer politischen Anschauung als BewerberIn abgelehnt.
Während alle religiösen Weltanschauungen unter den Begriff „Religion“ fallen, sind unter dem Begriff „Weltanschauung“ alle nicht religiösen Weltanschauungen zu verstehen, nicht religiöse Weltbilder, die sich als Leitauffassung vom Leben und der Welt als einem Sinnganzen verstehen.
Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit

Beispiele:
Der Prozentsatz an Schülerinnen und Schülern aus Roma-Familien in Sonderschulen in einem österreichischen Bezirk beträgt 50,3 %, während lediglich 1,8 % der nicht zur Gruppe der Roma zählenden Kinder der nationalen Mehrheitsgruppe in Sonderschulen unterrichtet werden. (EGMR-Urteil vom 13.11.2007 D.H. ua vs. Czech Republic)
Schülerinnen und Schüler einer national anerkannten Minderheit wird der muttersprachliche Unterricht verwehrt.
Roma sind häufiger TeilnehmerInnen des folkloristischen Rahmenprogramms einer Tagung als Referentinnen und Referenten der Tagung selbst.
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit ist eine rassistische Diskriminierung. Dabei dient der nationalen Mehrheitsbevölkerung die Tatsache, dass Menschen einer nationalen Minderheit angehören, dazu, diese Menschen als „fremd“ und „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Nationale Minderheiten (anerkannte Volksgruppen) in Österreich sind Sloweninnen und Slowenen, burgenländische Kroatinnen und Kroaten, Ungarinnen und Ungarn, Roma und Sinti, Wiener Tschechinnen und Tschechen, Wiener Slowakinnen und Slowaken.
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung

Beispiele:
Eine gehörlose Person wird im Betrieb, in dem sie beschäftigt ist, vom innerbetrieblichen Informationsfluss ausgeschlossen. Dies hat zum Beispiel zur Folge, dass ihr neue Arbeitstechniken nicht erklärt werden (vgl. Klagsverband Schlichtungsverfahren).
Der Mutter eines körperlich beeinträchtigten Kindes wird gekündigt, weil sie aufgrund der eingeschränkten Arbeitszeiten der Kinderbetreuung keine Überstunden leisten kann (vgl. EUGH-Urteil vom 17.07.2008 Rs C 303/06 Coleman).
Ein männlicher Rollstuhlfahrer hat nur über das Damen-WC Zugang zum Herren-WC.
Ein/Eine RollstuhlfahrerIn wird bei der Bewerbung um eine Arbeit am Schreibtisch aufgrund der Behinderung abgelehnt.
Einem Kind mit einer geistigen Behinderung wird in einer Kirche die Kommunion verweigert.
Einem Kind mit einer Behinderung wird die Aufnahme in die Integrationsklasse verweigert.
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit einer Behinderung ist eine behindertenfeindliche Diskriminierung. Dabei dient der Mehrheitsbevölkerung ohne Behinderung die Tatsache, dass Menschen eine Behinderung haben, dazu, diese Menschen als „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit einer Behinderung zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht. Alle körperlichen, geistigen, psychischen und Sinnesbehinderungen sind vom Diskriminierungsverbot umfasst. Die Behinderung muss keinen besonderen Schweregrad haben.
Diskriminierung aufgrund des Alters

Beispiele:
Einem Mitarbeiter einer Fluggesellschaft wird aufgrund seines Alters gekündigt, da der Betroffene ein Pilot ist, der das 60. Lebensjahr erreicht hat und das Unternehmen ein Berufsverbot für Piloten ab dem 60. Lebensjahr vorsieht (EUGH-Urteil vom 13.09.2011 Rs C 447/09 Prigge).
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit dem Alter ist eine jugend- oder altersfeindliche Diskriminierung. Dabei dient der Mehrheitsbevölkerung zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr die Tatsache, dass Menschen jünger als 25 oder älter als 50 sind, dazu, diese Menschen als „noch nicht dazugehörig“ oder „nicht mehr dazugehörig“ zu definieren.
Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit dem Alter zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht.
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung

Beispiele:
Zwei homosexuelle Männer wollen eine Wohnung mieten und werden abgelehnt (EGMR 24.07.2003 Karner/A).
Nachdem ein Mitarbeiter einer Firma seinen Arbeitskollegen von seiner Homosexualität erzählt hat, wird er von diesen durch heterosexistische Äußerungen und obszöne Beschimpfungen belästigt. (Landesgericht Salzburg GZ 18 Cg 120/05t und 18 Cg 121/o5i).
Die Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung ist eine heterosexistische Diskriminierung. Dabei dient der heterosexuellen Mehrheitsbevölkerung die Tatsache, dass Menschen homo- oder bisexuell sind, dazu, diese Menschen als „nicht dazugehörig“ zu definieren. Die Folge ist der Ausschluss dieser Menschen von Rechten und Ressourcen. Die konkreten Auswirkungen der Benachteiligung von Menschen im Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung zeigen sich am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche, beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen sowie in der (Nicht-)Teilhabe an wirtschaftlicher und politischer Macht. Die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft „toleriert“ und „reserviert“ einige kleine Räume für Homosexualität in der Öffentlichkeit: Es ist dies die „schrille“, „bunte“ und „laute“ Eventszene, durch die sich die nicht als schrill geltende Heteronorm unterhalten lässt. Ein Blick auf die gesamtgesellschaftliche und rechtliche Positionierung von Homosexuellen macht dagegen die tatsächlichen Diskriminierungen in aller Schärfe sichtbar: Im Bereich der Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe gibt es noch in einigen EU-Staaten und Staaten des Europarates Defizite. Im Adoptionsrecht einiger europäischer Staaten und Staaten des Europarates werden nach wie vor heterosexuelle Partnerschaften bevorzugt.
Und auch im Arbeitsleben finden homosexuelle Menschen nur sehr selten ein Arbeitsklima vor, das es ihnen ermöglicht, ihre sexuelle Identität nicht zu verstecken. Häufig überwiegt die Furcht vor Mobbing, Belästigung oder gar Kündigung.



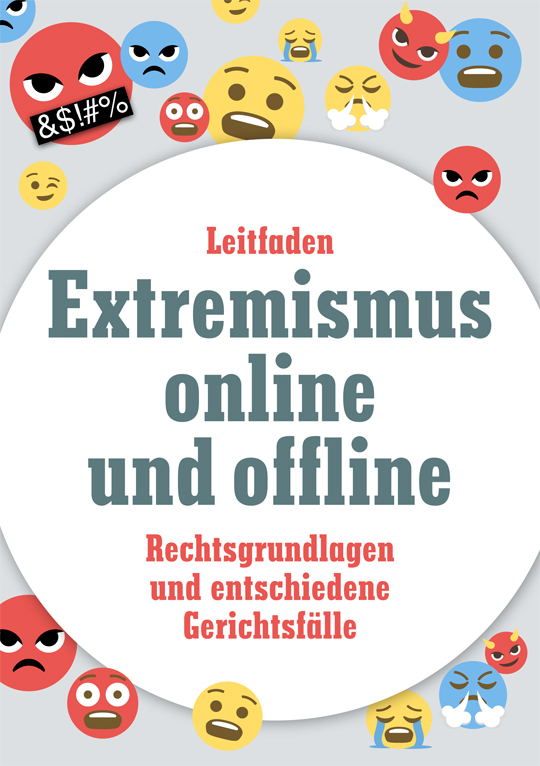 »
»