Stellungnahme: Religionen und Schulen
Der schulische Alltag ist geprägt durch kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Ereignisse. Angefangen beim Adventskranz und dem Adventskalender im Klassenzimmer, über die Weihnachtsbastelei im Werkunterricht, das Ostereierbemalen im Zeichenunterricht bis hin zu Schulgottesdiensten und den Weihnachts- und Osterferien, die sich an christlichen Festen orientieren. Nicht allen Menschen ist Religion wichtig, und es wäre vielleicht das Einfachste, zu versuchen, Religion weitestgehend von den Klassenzimmern fernzuhalten. Doch die Kontinuität und Stabilität von religiösen Feiern spielt insbesondere für Heranwachsende eine wichtige Rolle. Regelmäßig wiederkehrende positive Ereignisse können das Grundvertrauen fördern und ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. So stellt sich die Frage: Kann man im schulischen Alltag Religion leben und trotzdem allen SchülerInnen, unabhängig von Konfessionen, das Gefühl geben, dazu zu gehören? Wenn ja – wie? Und welche Chancen ergeben sich aus den Unterschieden?
Gesetzliche Grundlagen
Zum Umgang an österreichischen Schulen mit den unterschiedlichen Manifestationen verschiedener Glaubensrichtungen im Alltag der Menschen findet sich im Recht keine konkrete Vorgabe. Grundsätzlich kann daher jede Schule autonom entscheiden, wie sie mit der Situation umgehen möchte. Dennoch gibt es einige einschlägige rechtliche (Grundsatz-)Bestimmungen:
Art. 14 des österreichischen Staatsgrundgesetzes bestimmt, dass prinzipiell niemand zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit gezwungen werden kann. Dies findet seine Entsprechung in § 2a des Schulunterrichtsgesetzes, demzufolge die Teilnahme an Schülergottesdiensten und sonstigen religiösen Übungen oder Veranstaltungen den LehrerInnen und SchülerInnen freigestellt ist.
Die Schule ist zwar ein Ort, der politisch und konfessionell neutral sein soll (Verfassungsrecht der Gleichbehandlung), doch nimmt der christliche Glaube eine bevorzugte Stellung ein. Dies zeigt sich etwa in § 2b Abs 1 des Schulunterrichtsgesetzes: Wenn an einer Schule die Mehrzahl der Schüler einer christlichen Religion angehört, ist in allen Klassenräumen ein Kreuz anzubringen. Das Islamgesetz gewährt MuslimInnen grundsätzlich die gleichen Rechte, die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften gewährt werden. Trotzdem nehmen islamische Feiern an öffentlichen Schulen in Österreich nicht den gleichen Platz ein wie etwa Weihnachtsfeiern, auch wenn an manchen Schulen eine Mehrheit vorhanden wäre.
Art. 14 des österreichischen Staatsgrundgesetzes bestimmt, dass prinzipiell niemand zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit gezwungen werden kann. Dies findet seine Entsprechung in § 2a des Schulunterrichtsgesetzes, demzufolge die Teilnahme an Schülergottesdiensten und sonstigen religiösen Übungen oder Veranstaltungen den LehrerInnen und SchülerInnen freigestellt ist.
Die Schule ist zwar ein Ort, der politisch und konfessionell neutral sein soll (Verfassungsrecht der Gleichbehandlung), doch nimmt der christliche Glaube eine bevorzugte Stellung ein. Dies zeigt sich etwa in § 2b Abs 1 des Schulunterrichtsgesetzes: Wenn an einer Schule die Mehrzahl der Schüler einer christlichen Religion angehört, ist in allen Klassenräumen ein Kreuz anzubringen. Das Islamgesetz gewährt MuslimInnen grundsätzlich die gleichen Rechte, die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften gewährt werden. Trotzdem nehmen islamische Feiern an öffentlichen Schulen in Österreich nicht den gleichen Platz ein wie etwa Weihnachtsfeiern, auch wenn an manchen Schulen eine Mehrheit vorhanden wäre.
Sensibilisierung der PädagogInnen
Die überwiegende Zahl der österreichischen PädagogInnen ist römisch-katholischen Glaubens und war daher nie in der Situation, sich aufgrund ihrer Konfession diskriminiert zu fühlen. Vielen LehrerInnen ist womöglich gar nicht bewusst, dass beispielsweise ein muslimisches Kind ein „seltsames Gefühl“ dabei haben könnte, beim Singen von Weihnachtsliedern die Geburt Christi zu preisen. Eventuell ist daher eine Sensibilisierung notwendig, insbesondere, da es aufgrund jener religiösen Feiern, die von der Mehrheitsgesellschaft begangen werden, auch in vielen „unreligiösen“ Kontexten zu einer Diskriminierung kommen kann. Man denke dabei etwa auch an das Basteln von Osterschmuck im Werkunterricht o.ä.
In den Unterschieden Gemeinsamkeiten finden
Insbesondere Weihnachten spielt für Heranwachsende oft eine große Rolle. Das „Ereignis“ Weihnachten kann im schulischen Alltag einen Platz einnehmen, der weit über den christlichen Religionsunterricht hinaus reicht. Etwa beim bereits erwähnten Singen von Weihnachtsliedern im Musikunterricht, oder bei einem Wichtelspiel, das der/die Klassenvorstand/ändin organisiert.
Die Tatsache, dass nicht alle SchülerInnen einer Klasse die Vorfreude auf das Fest teilen, birgt einerseits die Gefahr, dass sich manche nicht als Teil der Klassengemeinschaft sehen und das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Andererseits spielen die regelmäßig wiederkehrenden religiösen Ereignisse oft eine wichtige Rolle im Leben der jungen Menschen und sollten daher nicht gänzlich aus dem schulischen Alltag ausgeklammert werden. Die religiöse Diversität der SchülerInnen stellt PadagogInnen nun vor die Herausforderung, trotz der Unterschiede Gemeinsamkeiten zu finden und so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Wenn dies nicht möglich scheint, könnten LehrerInnen die Möglichkeiten ausloten, SchülerInnen Optionen sowohl mit als auch ohne religiösen Bezug anzubieten. So kann jedeR seine verfassungsrechtlich gewährleistete positive und negative Glaubensfreiheit leben.
Die Tatsache, dass nicht alle SchülerInnen einer Klasse die Vorfreude auf das Fest teilen, birgt einerseits die Gefahr, dass sich manche nicht als Teil der Klassengemeinschaft sehen und das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Andererseits spielen die regelmäßig wiederkehrenden religiösen Ereignisse oft eine wichtige Rolle im Leben der jungen Menschen und sollten daher nicht gänzlich aus dem schulischen Alltag ausgeklammert werden. Die religiöse Diversität der SchülerInnen stellt PadagogInnen nun vor die Herausforderung, trotz der Unterschiede Gemeinsamkeiten zu finden und so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Wenn dies nicht möglich scheint, könnten LehrerInnen die Möglichkeiten ausloten, SchülerInnen Optionen sowohl mit als auch ohne religiösen Bezug anzubieten. So kann jedeR seine verfassungsrechtlich gewährleistete positive und negative Glaubensfreiheit leben.
Konfessionsübergreifender Religionsunterricht
Beim Religionsunterricht selbst handelt es sich paradoxerweise wohl um den unproblematischsten Bereich, da hier das Recht umfassende Wahlmöglichkeiten einräumt. Dennoch sollte er nicht von der Diskussion ausgeklammert werden, da gerade hier viel Potential besteht. Konfessionsübergreifender Religionsunterricht fördert den Dialog im Klassenzimmer. Die Möglichkeit, dass die SchülerInnen auch die ReligionslehrerInnen der anderen Konfessionen kennen lernen, und somit Informationen über andere Glaubensrichtungen aus erster Hand von einem Menschen bekommen, der seine Religion lebt und als wichtigen Teil seines Lebens betrachtet, bietet die Chance, dass die Heranwachsenden besonders viel Verständnis für kulturelle und religiöse Unterschiede entwickeln können – eine Kompetenz, die für das friedliche Zusammenleben stetig an Bedeutung gewinnt.
Universelle Werte, die das friedliche Zusammenleben in einer Gemeinschaft fördern
Im schlechtesten Fall kann Religion zu Ausgrenzung führen. Dies können PädagogInnen durch Kommunikation und Offenheit verhindern. Eventuell ist dafür der Mut notwendig, ungewöhnliche Wege zu beschreiten. Im Idealfall sorgt Religion für ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in einer übergeordneten Menschheitsfamilie und rückt Themen in den Vordergrund, die sonst im Unterricht vernachlässigt werden. Es gibt Werte, die sowohl von Atheisten, als auch gläubigen Menschen, egal welcher Konfession, als wichtig anerkannt werden. Werte, die dafür sorgen, dass Menschen trotz ihrer Unterschiede in friedlicher Gemeinschaft zusammen leben können. Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Toleranz können als solche universellen Werte betrachtet werden, die unabhängig von konfessioneller Zugehörigkeit vermittelt werden können.


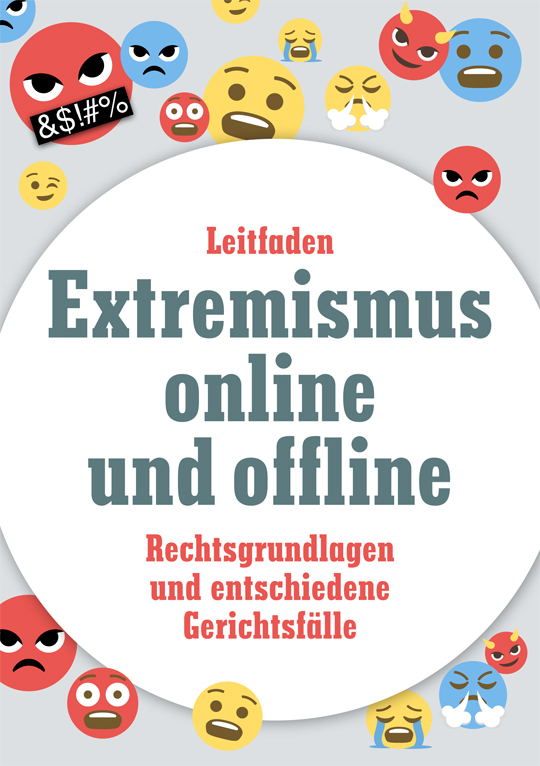 »
»